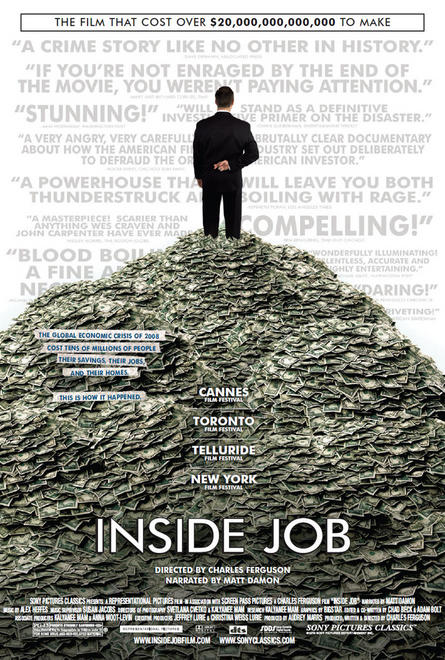Gibier d'Elevage/"Der Fang" (Rithy Panh) 7,86Die Geschichte einer Kriegsgefangenschaft, die Bewacher sind Kinder. Im Mittelpunkt steht ein junger Bursche, der blind dem neuen Regime folgt. Oft spielen die Kinder mit dem gefangenen amerikanischen Soldat, das Ende ist recht offen. Ein ruhiges, unspektakuläres, sehr „normal“, ohne jegliche Mätzchen gefilmtes Drama zum ewigen Thema Krieg, Regimeterror und Menschlichkeit.
The kids grow up/"Leben lernen" (Doug Block) 8,15Doug Block (
51 Birch Street) ist wieder da, wieder filmt er seine Familie und sich selbst, diesmal steht vor allem Tochter Lucy im Mittelpunkt, aber auch seine von Depressionen geplagte Frau. Der liebevolle Film ist eine Reflexion des Erwachenwerdens der eigenen Kinder und das Kreisen rund um den berüchtigten Tag, an dem die Kinder außer Haus sind und man als Paar wieder allein ist. Blocks Stil ist fast ein wenig naiv, aber dabei immer sympathisch. Auch wenn 90 Minuten sich für das alles auch mal ziehen, schaut man dem etwas zwanghaften Privat-Porträtisten gerne zu.
Mission Impossible - Ghost Protocol (Brad Bird) 8,19Wenn man sich Trailer zu Filmen wie
The Avengers oder
Underworld XX in Erinnerung ruft, dann genießt man diesen perfekt gemachten Actionknaller gleich viel mehr. Ohne allzu überdrüber-cooles-total überzogenes Heldenkino zu sein, machen vor allem die Dubai-Szenen viel Spaß, aber auch im Kreml oder in Indien ist die Mischung aus Action und Witz top; manchmal sogar atemberaubend.
Rabbit Hole (John Cameron Mitchell) 6,64Kühle Studie, zum Thema Verlust eines Familienmitglieds (die x-te!); die warme Musik kontrastiert die unterkühlte Stimmung, die Schauspieler überzeugen: es ist generell mehr so ein Schauspiel- als ein Regiefilm; eher konventionell, eher plätschernd, eher wenig packend: dann kommt plötzlich der Kniff mit dem
Paralleluniversum und damit endlich mal eine eigene, seltsame, aber ganz interessante Note. Angenehm ist auch, wie der Film allzugroße Dramatisierungen umgeht und leise seine Geschichte zum vorläufigen, leise optimistischen Ende bringt.
Secrets of the tribe/"Die Yanomami" (José Padilha) 5,75Doku über das kriminelle Verhalten von Anthropologen: formal nichts besonderes (talking heads), der Inhalt ist natürlich wichtig und auf bittere Weise erhellend; auch die Beschuldigten kommen zu Wort. Das Geplapper und Gestreite der Anthropologen ist aber auch eher ermüdend: am Ende deutet Padilha einen regelrechten Zirkus an, was die zuvor sehr ernste Beschäftigung mit dem Thema wiederum etwas relativiert. Der verstörendere Film zu sexuellem Missbrauch von Indios ist eindeutig
The Genius and the boys.
Somos lo que hay/"Wir sind was wir sind" (Jorge Michel Grau) 7,37Schnörkellos spannender kleiner Film mit einigen Drama-Parts, etwa den Reibereien in einer Familie nach dem Verlust des Vaters. Ohne besondere Erklärungen und ohne irgendwelche Sentimentalitäten gibt es diesen kurzen Ausschnitt aus einem dramatischen Tag dieser Famile zu sehen. Dabei geht es nicht gerade zimperlich zu. Diese Direktheit ist schon cool, Nachwirkung gibt es aber wenig. Durch sein spezielles Feeling aber sicher besser als viele andere “Genrebeiträge”.
Temple Grandin/"Du gehst nicht allein" (Mick Jackson) 7,60Es geht fast hysterisch, modern inszeniert und kurzweilig, aber wenig aufregend los. Es ist immer ein Problem, wenn normale Menschen „Behinderte“ spielen, das wirkt so gekünstelt. Dennoch macht Claire Danes ihre Sache gut. Der Film wird mit der Zeit sympathischer, eine schöne „feel-good“-Biografie, was vor allem an den charmanten Kuhszenen bzw. diesem in Filmen selten gezeigten Tier-Setting liegt.
Nostalgia de la Luz (Patricio Guzmán) 8,20Der Weltraum, was gibt es Schöneres? Der Film, ein Bilder- und Gedankenstrom, dann die Verknüpfung mit den vielen Leichen und Opfern des Pinochet-Regimes. Das ist berührend und spröde zugleich, manchmal auch großartig.
Lady Blue Shanghai (David Lynch) 5,30Formal ist das teilweise schön, mit den verwackelten Digibildern, aber inhaltlich ein äußerst laues Lüfterl: oberflächlich-hohle Geistergeschichte mit einem Hauch Selbstzitat aus
Mulholland Drive; ein völlig unbedeutender Werbefilm.
Orly (Angela Schanelec) 7,70Menschen am Flughafen – Schicksale, Begegnungen, Gespräche, eine zarte Ahnung von Liebe auf den ersten Blick. Schanelec zeigt uns vier „Paare“ – zwei Unbekannte, Mutter und Sohn, ein „echtes Paar“ und eines, das wir nie zusammen sehen: gefälliges Minimalismus-Menschen-Kino.