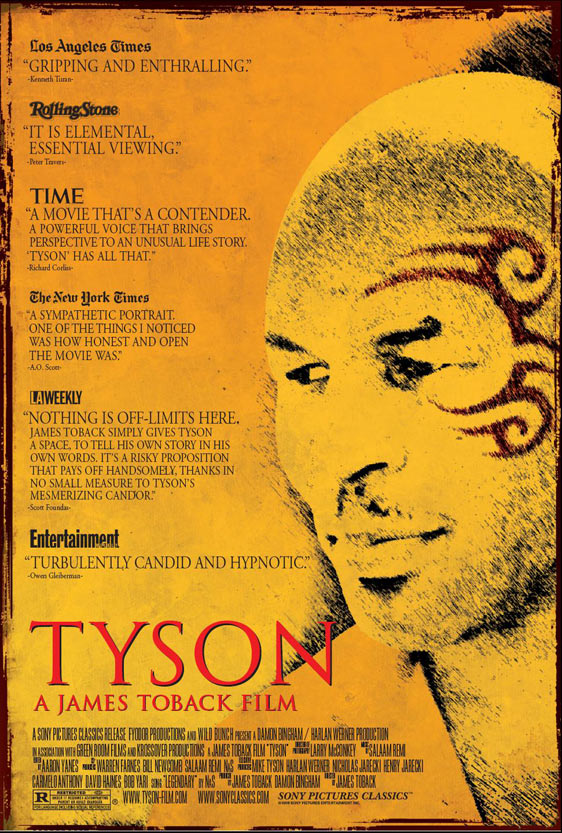Wie in seinem vorherigen Film Schläfer ist auch Heisenbergs Folgewerk sehr in der Authentizität verortet und dennoch oder gerade wegen dem "nach einer wahren Begebenheit" ist es auch ein absolut packender Genrefilm, ein Bankräuberdrama und ein Flucht vor dem Arm des Gesetzes-Thriller, gespickt mit typischen Elementen vergleichbarer Werke. Man fühlt sich bei den Banküberfällen natürlich an Point Break erinnert (der ja auch von der selben Geschichte inspiriert wurde, aber bekanntlich nicht die wahrhaftige Figur des "Pumpgun Ronnie" ins Zentrum rückte wie es bei Heisenberg geschieht) oder man meint später, eine realistische Version von "Auf der Flucht" zu sehen, der Thrillereffekt bleibt nämlich bei aller Bodenständigkeit der Inszenierung stets präsent.
Denn da ist dieser Anspruch immer spürbar, den Film nicht wie aus Hollywood gewohnt, (unnötig?) aufzublasen, sondern alles sehr lebensnah, realistisch wirken zu lassen und trotzdem hin und wieder Raum zu finden für wunderbare Regiegustostückerln wie etwa das seltsame Flirren der Lichter, die langsam näher kommen oder wilde Kamerafahrten (die Flucht durch Hinterhöfe usw.. oder der gemeinsame Marsch mit dem Bewährungsbeamten). Auch das Einspielen von Liveradio bei den Autofahrten ist eine effektive Idee, den Film authentisch zu gestalten und gleichzeitig zu vermitteln, dass hier ein Künstler mit einem Plan am Werk ist.
Auf der Charakterebene halten sich Heisenberg und Komplize/Romanvorlagengeber Martin Prinz sehr zurück und zeigen Rettenberger vor allem als schweigsamen Getriebenen. Nicht einmal seine Quasifreundin erfährt viel von ihm, von seinen Beweggründen oder Absichten, und schon gar nicht der Zuschauer, was den konsequent zu Ende geführten Film vermutlich in erster Linie besonders macht. Vor allem als passionierter (Weg-)Läufer bleibt sie uns in Erinnerung, diese faszinierende, rücksichts- und kompromisslose und doch so traurige, von Andreas Lust zum Fürchten (gut) gespielte Gestalt.
Dass Heisenbergs Film in manchen, essentiellen Punkten von der "wahren Geschichte" abweicht, obwohl er ja so realistisch wirkt, gehört sicher zum Kalkül und ist garantiert keine Schwäche. Heisenberg will mit seiner Arbeit vermutlich auch das Kino und den Umgang mit tatsächlich passierten Sensationsgeschichten als Inspirationsquelle selbst fragen und hinterfragen, aber daran kann man während der atemlosen Tempojagd zunächst eh kaum denken...das zeigt, dass Der Räuber sowohl zum unreflektierten Ansehen/Sich Hingeben als auch zum darüber Nachdenken gut funktioniert.
Denn da ist dieser Anspruch immer spürbar, den Film nicht wie aus Hollywood gewohnt, (unnötig?) aufzublasen, sondern alles sehr lebensnah, realistisch wirken zu lassen und trotzdem hin und wieder Raum zu finden für wunderbare Regiegustostückerln wie etwa das seltsame Flirren der Lichter, die langsam näher kommen oder wilde Kamerafahrten (die Flucht durch Hinterhöfe usw.. oder der gemeinsame Marsch mit dem Bewährungsbeamten). Auch das Einspielen von Liveradio bei den Autofahrten ist eine effektive Idee, den Film authentisch zu gestalten und gleichzeitig zu vermitteln, dass hier ein Künstler mit einem Plan am Werk ist.
Auf der Charakterebene halten sich Heisenberg und Komplize/Romanvorlagengeber Martin Prinz sehr zurück und zeigen Rettenberger vor allem als schweigsamen Getriebenen. Nicht einmal seine Quasifreundin erfährt viel von ihm, von seinen Beweggründen oder Absichten, und schon gar nicht der Zuschauer, was den konsequent zu Ende geführten Film vermutlich in erster Linie besonders macht. Vor allem als passionierter (Weg-)Läufer bleibt sie uns in Erinnerung, diese faszinierende, rücksichts- und kompromisslose und doch so traurige, von Andreas Lust zum Fürchten (gut) gespielte Gestalt.
Dass Heisenbergs Film in manchen, essentiellen Punkten von der "wahren Geschichte" abweicht, obwohl er ja so realistisch wirkt, gehört sicher zum Kalkül und ist garantiert keine Schwäche. Heisenberg will mit seiner Arbeit vermutlich auch das Kino und den Umgang mit tatsächlich passierten Sensationsgeschichten als Inspirationsquelle selbst fragen und hinterfragen, aber daran kann man während der atemlosen Tempojagd zunächst eh kaum denken...das zeigt, dass Der Räuber sowohl zum unreflektierten Ansehen/Sich Hingeben als auch zum darüber Nachdenken gut funktioniert.